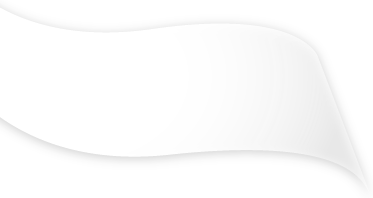![]()
Vom Menschen geschaffen
Steinriegel, Hecken und ein keltischer Wall
Anmerkung: Durch Anklicken der Bilder erhalten Sie eine vergrößerte Darstellung mit Bildunterschrift.
Sind Ihnen die Ansammlungen der Kalkscherben am Waldrand aufgefallen? Woher sie wohl stammen? Früher gab es hier auf der Kienbein-Berghalbinsel mehr Äcker als heute. Die Steine, die beim Pflügen an die Oberfläche kamen und bei der Bewirtschaftung lästig waren, wurden ausgelesen und an der Grundstücksgrenze oder am Waldrand aufgehäuft. Diese „Lesesteine“ bilden Wälle, allgemein Steinriegel genannt. Viele Steinriegel sind heute bewachsen und verstecken sich unter Hecken.
 Lesesteinhaufen begegnet man entlang des Ströhmfeldwegs immer wieder.
Lesesteinhaufen begegnet man entlang des Ströhmfeldwegs immer wieder.
Der Wall auf dem Kienbein
Etwa 50 Meter von hier Richtung Hülben, riegelt linker Hand ein von hohen Bäumen bewachsener Wall mit Graben die Berghalbinsel des Kienbeins an ihrer schmalsten Stelle ab. Die knapp 100 Meter lange Befestigung diente zur Verteidigung. Der Graben ist in die Felsen gehauen und war einst tiefer. Scherbenfunde in der Umgebung weisen auf eine Besiedlung in der älteren Eisenzeit, der Hallstattzeit (800 – 475 v. Chr.) hin. Aus dieser Zeit stammen auch die Grabhügel beim Burrenhof, während das keltische Oppidum Heidengraben (eine stark befestigte Stadt) ins 2. Jh. v. Chr. datiert wird.
Hecken – wichtige Elemente der Kulturlandschaft
Auf dem Kienbein gliedern Hecken die Landschaft. Meist wachsen sie auf Steinriegeln. Hecken bieten durch ihren stufigen Aufbau aus heimischen Gehölzen wie Weißdorn und Schlehe vielen Lebewesen Raum. Derartige linienhafte Strukturen haben eine wichtige ökologische Funktion als Ausbreitungs- und Verbindungswege für Flora und Fauna (Biotopverbund).
 Der Weißdorn ist eine typische Heckenpflanze und ein Blickfang besonders im Mai, wenn der Strauch weiße Blüten trägt.
Der Weißdorn ist eine typische Heckenpflanze und ein Blickfang besonders im Mai, wenn der Strauch weiße Blüten trägt.
Heckenlandschaften sind Lebensraum vieler Vogelarten (Neuntöter, Dorngrasmücke, Goldammer) und kleiner Säugetiere (Haselmaus, Mauswiesel). Fledermäuse finden als Nahrung ein reichhaltiges Insektenangebot. Wegen ihrer Bedeutung für den Artenschutz sind Hecken und Steinriegel in der Feldflur gesetzlich geschützt. Sie dürfen nicht beeinträchtigt oder zerstört werden.
 Der Neuntöter ernährt sich von Insekten. Was er nicht gleich frisst, spießt er in den Hecken als Vorrat auf Stacheln und Dornen auf.
Der Neuntöter ernährt sich von Insekten. Was er nicht gleich frisst, spießt er in den Hecken als Vorrat auf Stacheln und Dornen auf.
 Ein attraktiver und herrlich duftender Frühlingsbote hier am Wegesrand – der Seidelbast. Er bevorzugt Laubwälder mit kalkhaltigen, humosen Böden.
Ein attraktiver und herrlich duftender Frühlingsbote hier am Wegesrand – der Seidelbast. Er bevorzugt Laubwälder mit kalkhaltigen, humosen Böden.
 Die Waldeidechse sonnt sich gern auf Altholz, zum Beispiel auf Baumstümpfen oder alten Holzhaufen. Sie wohnt am Boden und klettert eher selten.
Die Waldeidechse sonnt sich gern auf Altholz, zum Beispiel auf Baumstümpfen oder alten Holzhaufen. Sie wohnt am Boden und klettert eher selten.