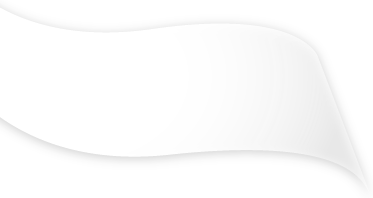![]()
Die Barnberghöhle
– eine typische Karsterscheinung
Anmerkung: Durch Anklicken der Bilder und Grafiken erhalten Sie eine vergrößerte Darstellung mit Bildunterschrift.
Auf der Schwäbischen Alb sind mehr als 2000 Höhlen bekannt. Das sind Gesteinshohlräume ab einer Länge oder Tiefe von fünf Metern. Die Barnberghöhle befindet sich rund 250 Meter von hier entfernt, etwas unterhalb des Albtraufs im Barnbergfels, im Unteren Massenkalk in der Formation der Unteren Felsenkalke (Weißjura δ).

Trofsteine entstehen, wenn im Wasser gelöster Kalk wieder ausfällt.
Es handelt sich um eine geräumige, trockene Karsthöhle mit Tropfsteinen und Höhlenlehm. Sie ist 46 Meter lang und diente den Menschen der Steinzeit als
Behausung, wie man aus Werkzeugfunden weiß.
Kalkgestein wird durch kohlendioxidhaltiges Wasser aufgelöst und ausgewaschen. Diesen Vorgang nennt man Verkarstung. Am Anfang zirkuliert das Wasser in feinen Klüften und weitet diese durch Lösung immer mehr, bis schließlich Spalten, Gänge und weitreichende, verzweigte Höhlensysteme entstehen. Die so dabei entstandenen Albhöhlen liegen heute zumeist trocken.

Eine Fledermaus (Großes Mausohr) hält Winterschlaf in einer Höhle.
Ein Teil des auf der Albhochfläche versickernden Wassers sammelt sich über den wenig wasserdurchlässigen Mergelgesteinen der Impressamergel (Weißjura α) und tritt am Fuß der Alb aus häufig wasserführenden Höhlen zutage. Ein Beispiel ist das nahe gelegene Bauerloch.
 In regenreichen Zeiten werden die Karstquellen am Hangfuß aktiv.
In regenreichen Zeiten werden die Karstquellen am Hangfuß aktiv.
Die Schüttung dieser Karstquellen unterliegt im Jahreslauf großen Schwankungen. Am meisten Wasser tritt nach heftigen Regenfällen und bei der Schneeschmelze hervor. In Trockenzeiten können diese Quellen auch versiegen. Karstquellen, die nur in sehr regenreichen Jahren fließen, werden auch Hungerbrunnen genannt, weil die Nässe in früheren Jahren meist eine Missernte und damit eine Hungersnot bedeutete.